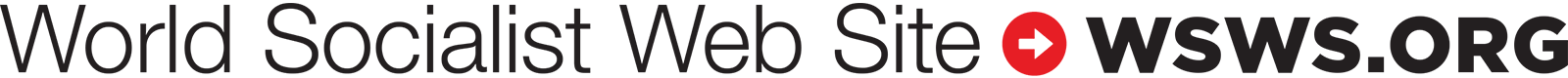Vergangene Woche wurde die so genannte Krankenhausreform im Bundestag beschlossen. Mit der Gesetzesänderung wird die flächendeckende Schließung von Klinken vorangetrieben und die Versorgung der Bevölkerung empfindlich verschlechtert.
Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP setzte sich in der Abstimmung durch. 374 Abgeordnete stimmten für den Gesetzentwurf, 285 dagegen, bei einer Enthaltung. CDU/CSU, AfD, Linke und die Abgeordneten des BSW hatten bereits vor der Abstimmung angekündigt, dagegen zu stimmen.
Dabei stimmen alle Oppositionsparteien grundsätzlich dem Abbau von Kliniken und Versorgung zu. Unstimmigkeiten gibt es vor allem in Bezug auf die Finanzierung, und teilweise gehen die Änderungen den Parteien nicht weit genug. Die Reform muss den Bundesrat noch passieren. Obwohl sie grundsätzlich nicht zustimmungsbedürftig ist, kann sie im Vermittlungsausschuss verzögert werden.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ließ keinen Zweifel an der Zielsetzung der Reform. Im Interview mit der Bild am Sonntag erklärte er: „Es ist ganz klar, dass wir in zehn Jahren spätestens ein paar Hundert Krankenhäuser weniger haben werden“. Angeblich gebe es für diese Kliniken „nicht den medizinischen Bedarf“. Schon jetzt stehe jedes dritte Bett leer, außerdem gebe es zu wenig Personal, so Lauterbach.
Tatsächlich ist der Leerstand nicht auf fehlenden medizinischen Bedarf zurück zu führen. Es ist der katastrophalen Sparpolitik der letzten Jahrzehnte geschuldet, die dafür gesorgt hat, dass viele Klinken heute unter akutem Personalmangel und gravierenden Finanzproblemen zu leiden haben. Bis Ende des Jahres könnte es aktuellen Schätzungen zufolge rund 80 Insolvenzen von Kliniken geben. Diese haben sich lange angekündigt und hätten durch die Unterstützung mit entsprechenden öffentlichen Mitteln verhindert werden können.
Die nun beschlossene Reform forciert diesen Prozess. Zentrale Punkte des Gesetzes sind dafür Vorhaltepauschalen und Leistungsgruppen. Die Vorhaltepauschalen ergänzen die weiterhin geltenden Fallpauschalen. Zukünftig erfolgt die Finanzierung der Krankenhäuser bis zu 60 Prozent über Vorhaltepauschalen, deren Höhe sich an der Ausstattung des Krankenhauses bemisst. Zu diesem Zweck sind 65 Leistungsgruppen (wie beispielsweise Kardiologie, Onkologie) definiert worden. Behandlungen können nur noch abgerechnet werden, wenn der Klinik die entsprechende Leistungsgruppe zugeteilt wurde und sie über die vorgeschriebene, meist sehr teure Ausstattung und das entsprechend qualifizierte Personal verfügt.
Kostendruck und chronische Unterfinanzierung bleiben bestehen und werden festgeschrieben, da die Fallpauschalen weiterhin bestehen und darüber hinaus die Voraussetzungen für die Vorhaltefinanzierung erfüllt werden müssen. Hinzu kommt, dass für das Vorhaltebudget die Jahre 2023 und 2024 als Indexjahre festgelegt wurden. Selbst bei steigenden Fallzahlen wird das Budget also nicht angepasst.
Zahlreiche Experten weisen darauf hin, dass die Verbindung von Fallpauschalen und Vorhaltefinanzierung gerade nicht dazu führt, dass bedarfsnotwendige Krankenhäuser in der Fläche ausreichend gegenfinanziert werden. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, merkte an, dass „weder die Grundversorgungskrankenhäuser in den ländlichen Regionen stabilisiert, noch die Konzentration hochspezialisierter Behandlungen in Zentren“ gefördert werden.
Weite Teile der Finanzierung der Reform sind noch immer offen. Klar ist, dass ein großer Anteil der Kosten direkt aus den Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung finanziert wird, also von den Versicherten. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Beitragssatz im Zuge dessen im kommenden Jahr um mindestens 0,8 Prozent erhöht. Je nach Krankenkasse könnte die Erhöhung aber noch weitaus größer ausfallen.
Gleichzeitig erhöht die Reform den Sparzwang der Krankenhäuser. Zu diesem Zweck sollen im Zuge der Krankenhausreform Krankenhäuser bis Ende 2030 ohne wettbewerbsrechtliche Prüfung fusionieren dürfen. Das geht aus final abgestimmten Änderungsanträgen der Regierungsfraktionen zum beschlossenen Gesetz hervor. Bis zuletzt wurden noch rund 50 Änderungen in das Gesetz eingepflegt.
Für den Zusammenschluss von Kliniken soll künftig eine Ausnahme von der Fusionskontrolle nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) geregelt werden. Damit sollen die Ziele der Krankenhausreform schneller erreicht werden. Durch Fusionen wurden es in der Vergangenheit Trägern möglich, einzelne Bereiche zu schließen oder zusammenzulegen und damit Personal einzusparen. Teilweise wurden Fusionen aber aus kartellrechtlichen Gründen abgelehnt. Aus diesem Grund werden Fusionen im Krankenhausbereich nun vollständig dereguliert.
Dies wird die Anzahl von Entlassungen an Kliniken weiter in die Höhe treiben. Bereits jetzt kommt es durch die angespannte Finanzlage immer häufiger zu Entlassungen an Krankenhäusern, während Ärzte und Pflegepersonal dauerhaft am Limit arbeiten.
Jüngst kündigte das Jüdische Krankenhaus Berlin (JKB) 74 Pflegehilfskräften, die dort teilweise seit über 30 Jahren beschäftigt sind und fast 20 Prozent des Pflegepersonals ausmachen. Die Geschäftsführung des JKB begründete diesen Schritt mit einer wirtschaftlich verschlechterten Situation.
Mit dem Inkrafttreten des 2022 beschlossenen GKV-Stabilisierungsgesetzes zu Beginn des Jahres, wird die Finanzierung des Pflegepersonals neu geregelt. Pflegehilfskräfte ohne entsprechende Ausbildung sind hier nicht mehr anrechenbar, obwohl sie wichtige Aufgaben wie Essensversorgung, Reinigung und Entlastung der Pflegefachkräfte zur Aufgabe haben.
Laut Pressemitteilungen will das JKB diese Leistungen zum Teil durch externe Dienstleister kompensieren, deren Mitarbeiter nicht den Tarifverträgen des JKB unterliegen. Den entlassenen Beschäftigten empfahl die Geschäftsführung zynischerweise, sich bei dem externen Dienstleister zu bewerben. Der größte Teil der Tätigkeiten wird aber sicherlich auf die verbleibenden Pflegekräfte abgewälzt.
Hier zeigt sich auch exemplarisch die Rolle der Gewerkschaft Verdi. Im Januar verkündete Verdi, man habe einen Entlastungstarifvertrag für die Beschäftigten „erkämpft“, der die Arbeitsbedingungen verbessert. Dabei ginge es angeblich um deutlich verbesserte Personalschlüssel und ein Kompensationssystem, das Ausgleich in Form von Ausgleichstagen oder Bonuszahlungen bietet. Tatsächlich ist dies auch am JKB, wie schon an anderen Kliniken, nichts weiter als Augenwischerei, um die Beschäftigten ruhig zu stellen.
Ein weiteres Beispiel sind die Regiomed-Kliniken in Bayern. Hier stehen betriebsbedingte Kündigungen an, bevor drei Standorte durch den Klinikkonzern Sana übernommen werden. Die genaue Zahl der Entlassungen wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben, Schätzungen gehen von 150 bis 200 Stellen aus.
Beim kommunalen Klinikverbund der Gesundheit Nord sollen 120 Arztstellen gestrichen werden – 80 Stellen davon am Klinikum Bremen-Mitte und 40 am Klinikum Bremen-Ost. Auch hier wurde die schlechte wirtschaftliche Lage als Grund genannt. Bremens Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) gilt als eine strikte Verfechterin von radikalen Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen und unterstützt explizit die Krankenhausreform von Lauterbach.