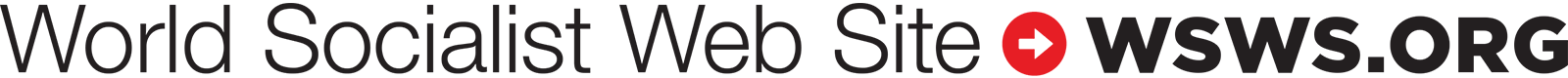Der international ausgezeichnete Kurzroman „Eine Nebensache“ (2017) der israelisch-arabischen Schriftstellerin Adania Shibli wurde auch in Deutschland bei seinem Erscheinen 2022 hochgelobt. Nach Ausbruch des palästinensischen Aufstands entdeckten Kritiker plötzlich Antisemitismus und erklärten Shibli zur BDS-Aktivistin. Die für Oktober auf der Frankfurter Buchmesse geplante Preisverleihung des mit dem Liberatur-Preis ausgezeichneten Romans wurde deshalb kurzfristig abgesagt. Worum geht es in dem Roman?
Der erste Teil berichtet über ein reales Verbrechen israelischer Soldaten, das sich 1949 zugetragen hat. Nach Ende des ersten israelisch-arabischen Krieges bauen sie in der Negev-Wüste einen Militärstützpunkt, um die Grenzgegend vor Ägypten von „verbliebenen Arabern zu säubern“. Eine Patrouille stößt auf „Eindringlinge“. Die Beduinen, die an einer von der Karte nicht erfassten Quelle siedeln, werden erschossen, nur ein Mädchen wird verschont.
Der militärische Erfolg wird mit einem Festessen gefeiert. Der Kommandeur hält eine Rede, lobt die Soldaten, die „mithalfen, diese Gegend zu verteidigen und zu beschützen“, und lässt sie zu fortgeschrittener Stunde über das weitere Schicksal des Mädchens abstimmen. Für die beschlossene Gruppenvergewaltigung wird ein penibler Drei-Tage-Plan ausgearbeitet. Am Ende wird das Mädchen in der Wüste erschossen und verscharrt.
Die Rede, die Araber zu kulturlosen Barbaren erklärt, ist eine der prägnantesten Stellen des Romans. Es gehe nicht an, „solch weite Landschaften, die geeignet sind, Tausende unseres Volkes aufzunehmen, die noch im Exil weilen, sich selbst zu überlassen. (…) Niemand hat mehr Anrecht auf dieses Land als wir, nachdem die Araber es über Jahrhunderte so verkommen haben lassen, dass heute nur noch Beduinen und ihre Herden hier leben. Wir dürfen sie nicht dulden; ja es ist unsere Pflicht, sie ein für alle Mal von hier zu vertreiben.“
Es ist eine klassische Kolonialrede, die aus der Zeit der Indianerkriege in Amerika, der Kolonialkriege in Afrika oder der Nazi-Besetzung Polens und der UdSSR stammen könnte. Zynisch endet sie mit dem Satz, den Siedler als Inschrift auf einer im letzten Krieg halb zerschossenen Mauer im jetzigen Militärstützpunkt hinterließen: „Nicht Kanonen werden siegen, sondern Menschen.“
Der zweite, fiktive Romanteil spielt in einer nicht ganz klar umrissenen Gegenwart. Eine palästinensische Journalistin aus Ramallah im Westjordanland, geb. 1974 wie Shibli, stößt auf einen Artikel über den Vorfall von 1949. Er weckt ihr Interesse, weil das Mädchen genau zum Zeitpunkt ihrer Geburt, 25 Jahre früher, ermordet wurde.
Um mehr über sie zu erfahren, fährt die Journalistin zum Museum der israelischen Armee nach Jaffa, dann in den Südwesten an den Ort der Tat. Von offizieller Seite erfährt sie keine Antwort. Sie besichtigt Waffen, Uniformen, alte Essbestecke und sieht zionistische Propagandafilme aus den 30er und 40er Jahren, die junge jüdische Migranten aus Europa bei genossenschaftlicher Landarbeit zeigen. Ein Film zeigt den Aufbau eines Kibbuz, eine Wehrsiedlung, wie der Wachturm verrät.
Zu spät erkennt sie, dass sie die normalen Menschen vor Ort fragen muss, die alten Leute mit ihren Erinnerungen. Am Ende wird sie dort, wo 1949 das Beduinenmädchen ermordet wurde, von israelischen Soldaten niedergeschossen. Zufällig war sie hierher geraten und hatte, die Gefährlichkeit der Situation unterschätzend, das militärische Sperrgebiet nicht beachtet.
Situationen, Grenzen erkennen, das war ihr schon immer schwergefallen.
Shiblis Blick gilt in dem Roman den kleinen „Nebensachen“, nicht dem „Gemälde“. Die Art des Sehens teilt sie mit dem Schriftsteller Peter Handke, dessen Roman „Unter Tränen fragend“ (2000) die Nerven zerrüttenden Grenzen in dem zerstückelten Gebilde beschrieb, das einmal der Vielvölkerstaat Jugoslawien gewesen war. Seit er die Nato-Bombardierung Serbiens 1999 verurteilt hatte, galt er plötzlich als Anhänger des „zweiten Hitler“ Milosevic.
Shiblis Roman zeigt, wie sich die Zerstückelung Palästinas und die israelische Besatzung in die Psyche der Bewohner eingebrannt hat. Die Journalistin hat ständig Angst, das Falsche zu tun. Plötzlich ist der Zugang zur Arbeitsstelle Sperrgebiet. Israelische Soldaten belagern das Nachbarhaus (obwohl Ramallah palästinensisch verwaltet wird). Sie nimmt einen Schleichpfad, ohne Zeit für Überlegungen, ob es gefährlich ist. Sie muss zur Arbeit.
Darf sie als Bewohnerin von Zone A überhaupt nach Jaffa fahren, weit außerhalb von Zone C? Viele Menschen passieren aus Angst nicht einmal den Übergang von Zone A zu B, den Kontrollpunkt Qualandia. Ihre arabische Arbeitskollegin leiht ihr ihren israelischen Pass mit den beruhigenden Worten, die Soldaten würden ihr aus Verachtung eh nicht ins Gesicht sehen. Auch die Beschaffung des Leihwagens gelingt ihr nur mit Trick und Hilfe.
Kurz hinter Ramallah ist sie orientierungslos. Die trostlose Betonmauer entlang des Flughafens, wo früher „nur“ Stacheldraht war, neue Siedlungen statt Palästinenserdörfer, neue Namen und Verweise. Darf man hier lang oder muss man einen Umweg fahren? Vor dem Checkpoint stauen sich Autos, Leute, die zur Arbeit wollen oder auf den Markt. Auch der Leser verliert die Orientierung. Auf welcher Seite der Mauer ist man eigentlich?
Der Vorwurf, der Roman zeige plakativ anonyme Vergewaltiger und Killer statt Charaktere, den Staat Israel selbst als „Mordmaschine“, hat einen durchschaubaren Hintergrund. Schon als 2005 die israelische Zeitung Haaretz das erste Mal über das Verbrechen von 1949 berichtete, beeilten sich militärische Zeitzeugen, dies als furchtbare Entgleisung abzutun.
Die aktuelle Forderung nach Soldaten-Charakteren dient derselben Relativierung.
Shiblis beiläufige Schilderungen einer Militärdiktatur, in der Soldaten einfach Soldaten sind, die einen staatlichem Auftrag erfüllen, erregte erst öffentlichen Widerspruch, als die Palästinenser sich gegen ihre jahrzehntelange Unterdrückung massiv zur Wehr setzten. Im Grunde genommen schildert das Buch die vielen „Nebensachen“, die den Aufstand sehr nachvollziehbar machen.
In der nüchternen Darstellung der unhaltbaren Zustände, die im Roman richtig als Fortsetzung dessen erscheinen, was in den Jahren um die Gründungszeit Israels begann, besteht seine Stärke, nicht in seinen existentialistisch geprägten pessimistischen Spekulationen über menschliche Kontrolle und Grenzen als solche.
Welcher Leser erinnert sich angesichts der Gleichsetzung von Arabern mit Tieren durch den israelischen Verteidigungsminister nicht an die Gleichsetzung von Arabern mit Ungeziefer durch den fiebernden Kommandeur 1949 im Roman. Seine Truppenansprache könnte auch Biden oder ein anderer, heutiger Großmachtpolitiker gehalten haben. Die rasante Entwicklung des Militarismus und Neokolonialismus drängt historische Vergleiche geradezu auf.
Eine gelungene Metapher für die durchlässige Grenze zwischen Gestern und Heute sind im Roman die Hunde. Ihr Heulen und Bellen ist allgegenwärtig. Sie waren überall dabei, sind Zeitzeugen und Mahner gegen das Vergessen. Nach dem Tod des Beduinenmädchens, nähert sich ihr Hund dem Bett des kranken Offiziers und beschnuppert seine Hand. Wird er die Hand beißen oder lecken?
Letzteres verlangen die rechten Kritiker des lesenswerten Buches von der seit 75 Jahren im Gazastreifen und der Westbank unterdrückten palästinensischen Bevölkerung. Auf der inzwischen restaurierten Mauer des einstigen Tatortes von 1949, der zu den ersten palästinensischen Angriffszielen gehörte, prangt wie zum Hohn immer noch die Inschrift: „Nicht Panzer werden siegen …“